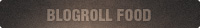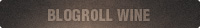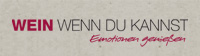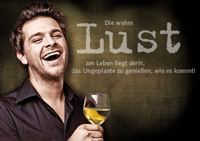Zugegeben, ich bin ein wenig stolz auf die Tatsache, dass in diesem Blog schon vor geraumer Zeit die Tatsache beklagt wurde, dass das Beaujolais von vielen Weinfreunden so sträflich unterschätzt wird. Auch von Beaujolais-Ausnahmewinzer Jean Paul Brun und seinen Weinen war in diesem Zusammenhang die Rede1.
Hier geht es heute um ein anderes Erzeugnis aus dem Hause Brun, nämlich den FRV1002. Die vormittäglichen Vorbereitungen zum Straßenkarnevals-Auftakt im hiesigen Haushalt mit dem Eintreffen diverser Freundinnen der Dame des Hauses schienen mir eine gute Gelegenheit, um den schon seit langem geplanten Vergleich zwischen dem Erzeugnis von Jean Paul Brun und dem “Le 7″, zu dem ich ja bekanntermaßen kein völlig neutrales Urteil fällen kann. Besser wäre natürlich ein Vergleich im Sommer gewesen, wo die beiden Perlweine eigentlich erst ihre volle Wirkung entfalten. Perlweine übrigens, weil beide im Gegensatz zu Sekt, Champagner, Cava und Spumante nur eine Gärung durchlaufen und es sich damit im weinrechtlichen Sinne nicht um Sekte handelt. Wer übrigens genauer wissen will, wie die Herstellung von statten geht, den empfehle ich, sich die Kommentar zu diesem Artikel durchzulesen.
Beide sind nach der gleichen Methode hergestellt, ebenso wie aus der gleichen Rebsorte. Und so sind sich die beiden Kandidaten dann auch folgerichtig recht ähnlich. Der Le 7 ist etwas intensiver in der Farbe und nach wie vor mit jener überbordenden Himbeer- und Erdbeerfrucht gesegnet, die ihn nicht nur zu einem von Ankes bevorzugten Getränken hat werden lassen. Der FRV100 ist etwas heller, hat noch weniger Alkohol (gerade mal 7,5%) und auch etwas weniger (aber immer noch deutliche!) Restsüße. Auch hier überwiegen rote Früchte, aber bei weitem nicht so intensiv. Dafür dann genau jene angesichts der Rebsorte Gamay eher überraschende Tiefe, die auch die Stillweine von Brun auszeichnet. Ungemein schmeichelnd an der Oberfläche, darunter aber lauert ein Abgrund. Zwar sehr, sehr weit entfernt. Aber man spürt ihn dennoch. Toll!
Welcher Wein der bessere ist, darüber gehen die Meinungen der Anwesenden auseinander. Aber egal für welchen man sich auch entscheidet: Ich lehne mich an dieser Stelle mal ein wenig aus dem Fenster und behaupte: Von dieser, im Vergleich zur Methode Champenoise um mehrere hundert Jahre ältere Methode, prickelnde Weine herzustellen, werden wir in den nächsten Jahren noch öfter hören, davon bin ich überzeugt (oder hoffe es doch zumindest).
Im letzten Sommer konnte man jedenfalls in Languedoc schon an keinen Schaufenster eines Wein- oder Feinkosthändlers mehr vorbeigehen, ohne dass neben den üblichen Champagner-Verdächtigen nicht auch ein oder gar mehr Ancestrals gestanden hätten. Im Oktober bin ich beim Foodcamp in Cilento dann über etwas gestolpert, dass wenigstens von der Produkt-hilosophie her sehr, sehr ähnlich war (dazu bald ein paar Worte im immer noch ausstehenden letzten Cilento-Bericht):
Es kann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich die ersten mutigen deutschen Erzeuger dieser Art der Schaumwein-Erzeugung widmen. Und wenn ich mir beispielsweise überlege, was jemand wie beispielsweise Hanspeter Ziereisen an Ergebnissen damit erzielen könnte, kann ich es kaum noch erwarten…
- Genau diesem Thema und diesem Winzer widmet sich auch der höchst umtriebige Hendrik Thoma im zweiten Beitrag seines neuen, jetzt händlerunabhänigen Video-Blogs namens Wein am Limit. ↩
- Den Besitz dieser Flasche verdanke ich übrigens der gleichen Person, die mich vor geraumer Zeit mit den Weinen von Jean Paul Brun bekannt gemacht hat. Danke für beides, Matze! ↩